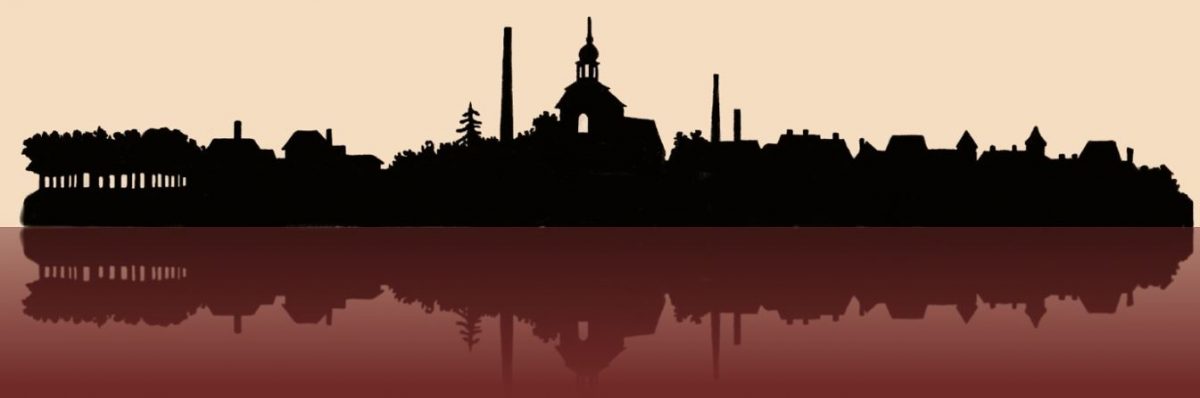Hufner, Kätner, Altenteiler, Erbpächter, Parzellisten u. a.unterschiedliche Bezeichnungen im Bauernstand

Der Bauernstand (auch die Bauernschaft, das Bauerntum) besteht aus Eigentümern oder Pächtern, die als Hauptberuf selbständig einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb betreiben. Seine Aufgabe ist die Gewinnung von Lebensmitteln, Nahrungsmitteln, Naturmaterialien, Energierohstoffen, also der Gesamtheit der Landwirtschaft, und teils der Forstwirtschaft. Als Folge der landwirtschaftlichen Nutzung bildete sich durch die Arbeit des Bauern die Kulturlandschaft unseres ländlichen Raumes aus, die heute zunehmend auch durch Industrie und Gewerbe geprägt wird. Die Bauern waren jahrhundertelang der niedrigste Stand in unserer Gesellschaft. In der heutigen Zeit sind viele von ihnen Unternehmer, die ihr Einkommen zusätzlich durch ergänzende Aufgaben wie Eigenvermarktung oder Tourismus beziehen.
Im geschichtlichen Kontext unterscheidet sich unfreies und freies Bauerntum. Freie Bauern bewirtschafteten ihr eigenes Grundeigentum, Zinsbauern waren persönlich frei, hatten aber Abgaben an den Grundherrn zu entrichten, Hörige mussten Frondienste und Abgaben leisten, Leibeigene waren persönliches Eigentum des Grundherrn.
Für die Bauern in den Vikariendörfern, die dem Domkapitel zu Lübeck unterstanden, hatte sich gegenüber dem Mittelalter mit der Säkularisierung 1803 nicht viel geändert, doch standen sie sozial und wirtschaftlich besser da als ihre Nachbarn im gutswirtschaftlichen System in Dunkelsdorf (und im nördlichen Ostholstein). Sie waren persönlich frei (PRANGE 1973). Es galt der Spruch: „Unter dem Krummstab lebt es sich besser“. Mit der Angabe des „Zehnten“, der der Kirche zunächst noch in Naturalien abgegeben wurde, konnte man gut auskommen.
Auf welche Weise Ritter und Fürsten große Grundbesitzer werden konnten, dafür bietet Plöner Herzog Hans/Johann der Jüngere ein anschauliches Beispiel. Schon mit dem dänischen König Friedrich I. erhielten die Grundherren 1524 die Gerichtsbarkeit bei Hals und Hand, also die hohe und niedere Gerichtsbarkeit, über ihre Untertanen. So gelangten die Ahrensböker Untertanen für mehr als 200 Jahre in die Leibeigenschaft, wenn sie sich nicht wie die Dangmersdorfer Hufner entschieden, ihr Dorf zu verlassen und in den Einflussbereich des Domkapitels zu ziehen (JARCHOV 1979a S.43). Unter Herzog Friedrich Carl wurden umfassende Agrarreformen in Gang gesetzt, um mit einer leistungsfähigeren Landwirtschaft das wirtschaftlich ruinierte Herzogtum Plön zu einem Aufschwung führen zu können. So überraschte es, als die Bewohner des ganzen Dorfes Barkau schon 1735 aus der Leibeigenschaft entlassen und Erbpächter wurden. Diese Initiative setzte sich auch in anderen Dörfern des Ahrensböker Gebietes durch, indem man nach und nach die Domänen verkaufte: 1746 Dakendorf, 1767 Hohenhorst, 1771 Neuhof und 1776 Ahrensbök (JARCHOV 1979a S.48).
Nach sächsischem Recht war Grundbesitz unteilbar und wurde auf einen Sohn vererbt. Seit 1867 gehört das Amt Ahrensbök zum Großherzogtum Oldenburg, in dem das Recht galt, das den jüngsten Sohn zum Hoferben machte.

Die Bauernkolonisation des 12. Jahrhunderts brachte Siedler aus Westfalen, Friesland, Hessen, Holland und anderen Regionen ins Land. Aber auch holsteinische Bauernsöhne kamen in die neu gegründeten Dörfer. Zu jedem Bauernhof gehörte eine Hufe, die ein Hufner (Vollhufner) bewirtschaftete. Ihm gehörte nur Haus und Hofwehr (Land um das Haus hieß „Kohlhof“). Alles andere, „Land und Sand“ genannt, gehörte dem Grundherrn (Herzog, Adel oder Kirche). Das Roden des Waldes, um Ackerfläche zu gewinnen, war Aufgabe der Dorfgemeinschaft gewesen. Die Ackerflächen wurden durch hohe geflochtene Zäune vor dem Wild und dem Weidevieh geschützt. Die hauptsächlich der Steuerberechnung dienende Wirtschaftseinheit war die Hufe, von der ein Bauer mehrere oder auch nur ein Bruchteil besitzen konnte. Die Hufe bedeutete das Recht zur Bebauung eines bestimmten Bruchteils der Dorfflur, nämlich so viel mit einem Pferd bewältigt werden konnte und so viel für die Ernährung einer Familie nötig war. Das Maß wechselte nach der Güte des Bodens und anderen Gesichtspunkten. Die Hufe hatte ursprünglich eine Größe von 30 Morgen (zwischen 6 und 18 ha je nach Region). Im 19. Jahrhundert besaß ein Vollhufner durchschnittlich von 40 bis 50 ha.
Der Lokator eines Dorfes übertrug die untere Rechtsprechung und meist auch das Schankrecht einem Bauern im Dorf, dem Bauervogt. Er galt als dörfliche Respektsperson. Der Name Vogt leitet sich aus dem Lateinischen ‚advocatus‘ ab, wörtlich „der Herbeigerufene“. So steht die Bezeichnung Advokat bzw. Vogt für eine Person mit der Befugnis, andere zu schützen und zu vertreten. Er vermittelte zwischen dem Grundherrn bzw. fürst(bischöf)lichen Ämtern und deren Untertanen. Er versah Aufsichtsfunktionen im Dorf und in der Feldmark. Er hatte gelobt, den Nutzen des Landesherrn zu mehren und Schaden von ihm abzuwehren. Verbrechen hatte er der Herrschaft zu melden. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, neue Verordnungen bekannt zu machen. Letzteres geschah gewiss größtenteils in der „Bursprake“, der Bauernversammlung. Für das Amt des Bauervogts wurden immer wieder bestimmte Privilegien erteilt. Der Vogt hatte keinen Hofdienst auf fürst(bischöf)lichen Domänen zu leisten und war von Truppeneinquartierungen befreit. Im Kern war der Inhalt der Amtsverleihung 1853 noch derselbe wie 1610. Ein Bauervogt wurde zwar nicht von den Dorfbewohnern gewählt, war aber Hufner (Landwirt) im Dorfe, dessen Hufenstelle mit dem Amt des Bauervogtes gekoppelt war. Das Amt vererbte sich also mit dem dazugehörigen Bauernhof.
In den neu gegründeten Dörfern bestanden neben den Hufen auch Katenstellen, die von Kätnern (Eigenkätner) bewirtschaftet wurden, aber nur wenig oder gar kein Land hatten und deshalb meist zusätzlich oder nur ein Handwerk ausübten. In älterer Zeit kommt es vor, dass Kätner auch als Büdner bezeichnet werden. Je nach Landbesitz wurden sie auch als Halbhufner, Viertelhufner, Dreiviertelhufner, Achtelhufner, Zwölftelhufner usw. bezeichnet.
Im Falle der Weitergabe des Besitzes wurden die Vorgenannten zu Altenteilern, Altenteilskätnern oder Althufnern. Häufig kam es vor, dass der erbberechtigte Sohn noch nicht die Volljährigkeit (mit 26 Jahren) beim Tod seines Vaters erreicht hatte oder die erbberechtigte Tochter noch nicht verheiratet war. Dann wurde ein Interimshufner (Pächter oder Verwandter) eingesetzt. Es konnte aber auch ein Setzwirt in diesem Fall zum Zuge kommen, indem er die Witwe des verstorbenen Hufners heiratete und die Hufe bis zur Einsetzung des Hoferbens wirtschaftlich führte und erhielt. Nach längerer Setzwirtzeit erhielt er oft ein Altenteil auf der Hufe. Es kam aber auch vor, dass der Setzwirt nach der Witwenheirat Besitzer der Hufe wurde.
Hufner, die ihren Hof nicht selbst bewirtschafteten, wurden teils auch als Hufenbesitzer oder Eigentümer bezeichnet. Sie überließen die betriebliche Führung ihres Hofes einem Verwalter, Häuermann oder Häurer, Wirtschafter oder einem Pächter (Hufenpächter).

Sowohl für Hufner, als auch für Kätner, gibt es in Abgabeverzeichnissen, Volkszählungen und Kirchenbüchern auch die allgemeinere Bezeichnung Hauswirt, sodass in diesem Fall nicht klar ist, ob ein Hufner oder ein Kätner gemeint ist.
In den ehemaligen Vorwerken Ahrensbök, Hohenhorst und Neuhof wurde das Land an Erbpächter oder Parzellisten vergeben. Erbpächter vererbten ihre Stelle an einen Sohn oder veräußerten mit Zustimmung des Grundeigentümers die Stelle. Das BGB sah ab 1900 die Erbpacht nicht mehr vor, aber in Schleswig-Holstein galt sie als Landesrecht weiter bis 1947. Parzellierungen wurden bei der Auflösung von Gutsbetrieben (siehe Dunkelsdorf) oder Vorwerken (siehe Hohenhorst und Neuhof) vorgenommen. Pächter auf Lebenszeit nannte man Lanste (Landsasse), bekannt ist z. B. der Pfarrlanste Lübbert in Wulfsdorf (1786-1848).
Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert vollzog sich in der ländlichen Sozialstruktur eine dynamische Entwicklung, durch die sich die Anteile der bäuerlichen Besitzgrößen nicht nur objektiv verschoben haben, sondern auch subjektiv die Grenzen, bei denen ein Dorfbewohner der einen oder anderen Kategorie zugerechnet wurde. Daraus resultieren Unterschiede in der ländlichen Sozialstruktur, was sich auf die Heiratsgepflogenheiten und die soziale Mobilität auswirkte. Weithin blieb es aber dabei, dass Hufner und Kätner unter ihresgleichen heirateten und ihre Ehefrauen aus dem östlichen Holstein stammten.
Die Hufnergesellschaft bildete in den Landgemeinden des Großherzogtums Oldenburg zusammen mit den Eigenkätnern bis 1933 den Gemeinderat. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die Begriffe Landmann oder Bauer auf, die aber nichts darüber aussagten, ob derjenige auch der Stellenbesitzer war. Häufig wurden zunächst die Söhne eine Stellenbesitzers Landmann genannt, so sie denn auf dem Hof mitwirtschafteten. Durch die Bildung der Großgemeinden 1933 wurde der Begriff Hufner offiziell nicht mehr verwendet, denn das Reichserbhofgesetz schrieb vor, dass nur der Eigentümer eines Erbhofes (nicht größer als 51 ha) Bauer heißt und der Eigentümer oder Besitzer eines anderen landwirtschaftlich genutzten Grundeigentums Landwirt heißt.
Außerhalb der bisher genannten Bauernständler wären hier noch die wenigen Gutsbesitzer unseres Gebietes in Dunkelsdorf und Siblin zu nennen, die ebenfalls in den Listen der Dörfer aufgeführt sind. Ebenfalls aufgeführt sind die Mühlenbesitzer oder -pächter.
Anfang des 20. Jahrhunderts kam als neue Besitzform die Genossenschaft auf. In manchen Dörfern schlossen sich einige Bauern zusammen, um auf einer Stelle gemeinsam eine Meierei zu betreiben. Zur gleichen Zeit kam es immer häufiger vor, dass neue Besitzer der Stellen keine Landwirtschaft mehr betrieben oder in der Inflationszeit 1914-23 Stellen als Immobilie erwarben, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen.
Für die Zeit vor 1740 sind die Recherchemöglichkeiten zu den Familien des Ahrensböker Raumes nur unzureichend gegeben. Die Kirchenbücher des Kirchspiels Curau fehlen hierzu völlig, die anderen Kirchenbücher der Kirchspiele Ahrensbök, Gleschendorf und Sarau halten zum Teil nur knappe Informationen bereit.
Der Autor Rainer Wagner arbeitet derzeit an einem historischen Bauernverzeichnis mit Besitzfolgen für alle Ahrensböker Dörfer: „Die historischen Bauernschaften in Ahrensbök und seinen 19 Dörfern. Gutsbesitzer, Hufner, Kätner, Stellenbesitzer, Pächter und Setzwirte.“