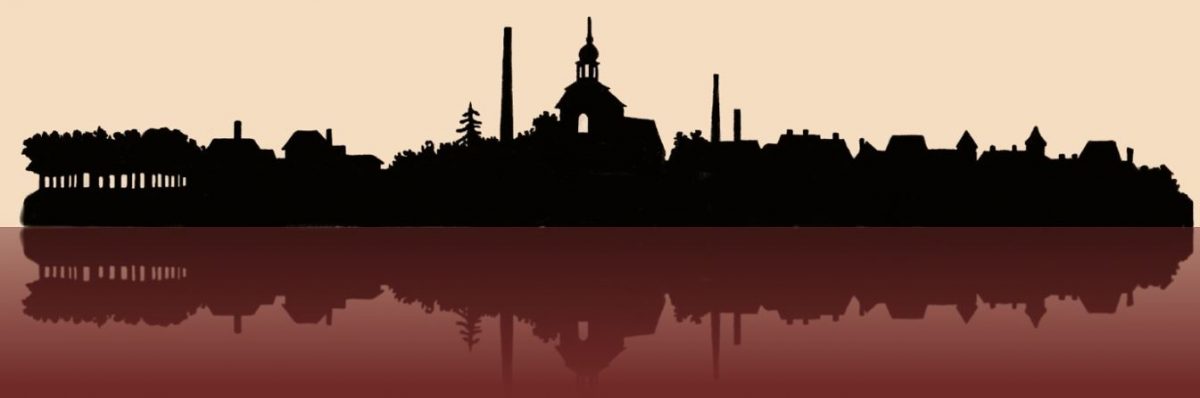70 Jahre Siedlung Dunkelsdorf
Die Ostholsteinische Landsiedlung in Eutin hat im Jahre 1953 das 264 ha große Gut Dunkelsdorf von der ehemaligen Besitzerin Frau Schulz erworben. Sie war eine Nachfahrin des jüdischen Kaufmannes Rudolf Brach in Hamburg und welche zuletzt in Lima/Peru wohnhaft war. Es wurde in 12 Neubauernstellen aufgeteilt und überwiegend an Heimatvertriebene Bauern aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten vergeben. Dies wurde mit zinsverbilligten Darlehen gefördert und so sollten die Kriegsflüchtlinge wieder eingegliedert werden. Sie hatten in ihrer alten Heimat ihre Höfe verloren und begannen hier, sich eine neue Existenz und Heimat zu schaffen. Obwohl die meisten der Siedler schon ein Alter von 50 Jahren überschritten hatten, fassten sie den Mut, nochmals neu zu beginnen; heute würde man in dem Alter ans Aufhören denken.
10 neue Hofstellen wurden an dem Privatweg und entlang der Ahrensbök – Lübecker Landstraße erstellt. Aus den Gutsgebäuden entstanden die beiden Resthöfe, so aus dem ehemaligen Pferdestall das Wohn – und Wirtschaftsgebäude des Bauern Ahrens. Die Landarbeiterhäuser wurden in Nebenerwerbsstellen umgewandelt und an die ehemaligen Landarbeiter abgegeben. Es wurden auch einige Landkorrekturen mit Grenznachbarn durchgeführt und die schon früher verpachtete Fläche der Bergkoppel vom Neuhof an die Kirchengemeinde Ahrensbök verkauft. Das Herrenhaus mit dem Park kaufte Frau Hellmy Plasswich und errichtete einen Hotelbetrieb. Das „Herrenhaus zur Rose“ wurde weit über die Landesgrenzen bekannt.
Im Jan./ Feb. 1955 wurden die Höfe bezogen, außer der von Ahrens. Diese kamen erst im Herbst nach der Abwicklung durch die Verwalter der Landgesellschaft. So können die Siedler in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen der Siedlung Dunkelsdorf begehen. Einige Zeitzeugen können noch über den Neubeginn berichten.
Die Gebäude sind als kombinierte Wohn – und Wirtschaftsgebäude erstellt und für 8 Kühe, 2 Pferde und einige Schweine ausgelegt. Für die um die etwa 6 Personen großen Familien standen 2 Zimmer zur Verfügung, die Wände waren gekalkt und mit einem farbig aufgerollten Muster versehen. Es gab eine Toilette mit Zinkeimer im Haus. Durch die eigens für die Siedlung geschaffene Wasserversorgungsanlage im dem 70m tiefen Brunnen im Park beim Herrenhaus gab es fließendes Wasser und jeder hatte eine Zapfstelle im Haus und im Stall. Später schloss sich das ganze Dorf mit an. Die Anlage liefert bis heute noch vorzügliches Trinkwasser. Fast alle Siedler bauten sich bald weitere Zimmer im Obergeschoss aus.
Die Siedlungshöfe von Arno bzw. Eitel Rapelius, Otto Czyttrich, Richard Marowski, Theodor Zemke, Hans Zuther, Walter Struck und Albert Manthey hatten eine Größe von ca. 17 -18 ha. Die Höfe von Karl Ziel, Heinrich Jungenkrüger und Wilhelm Kibbel waren etwa 9 ha groß, die beiden Resthöfe von Gustav Ahrens (sen.) 33ha und Fritz Böttcher, der ihn 1960 an Walter Hamann abgab, ca.38 ha groß.
Der Anfang war recht schwierig. Es gab keine befestigte Hofzufahrten. Sie waren bei Regenwetter grundlos, und um die Gebäude herum lagen große Lehmberge vom Keller, den Fundamenten und der Jauchegrube. Als Feuerschutz musste eine dicke Lehmschicht auf die Heubodendecke gebracht werden und der Rest kam in die Gräben der Wiesen und Weiden. Von der Ahrensböker Ziegelei holte man sich Ziegelbruch zur Hofbefestigung. Es fehlten fast alle Gerätschaften, von der Forke und Schubkarre bis zum Eimer und der Milchkanne. Die Händler und Vertreter sahen ihre Chance und gaben sich die Klinke in die Hand. Es gab keinen schützenden Baum oder Strauch auf dem Hofplatz, und so gab es auch bald die ersten Sturmschäden an den Gebäuden.

Vom Gutshof, der sich in der Auflösung befand, konnte man sich Milch für die Familie holen und in der Schule hat sich die Zahl der Schüler fast verdoppelt. Im Vorjahr hatte die Siedlungsgesellschaft für die Neusiedler in der Parknähe schon Diemen mit Heu und Stroh angelegt und einen Teil der Ackerfläche mit Winterroggen bestellt. Die nasse Herbsteinsaat war jedoch sehr ungünstig und die mit der aufwachsenden Kamille sorgte sogleich für einen schlechten Ertrag.
Vom Gutshof wurden auch Kühe (jeweils 4 im Pack), Pferde und Gerätschaften zum Kauf angeboten. Fast alle Siedler begannen mit Arbeitspferden an zu wirtschaften und beschafften sich entsprechende Maschinen, oft in Gemeinschaft, und Vieh um sich einen Viehbestand auf zu bauen. Doch um ein gutes Nachbarschaftliches Verhältnis nicht zu belasten war die Maschinengemeinschaft nicht immer von Vorteil da doch jeder zur gleichen Zeit das Gerät brauchte.
Die Ställe wurden erweitert und Schuppen und Scheunen gebaut. Als eine der wichtigsten Maschinen zu Arbeitserleichterung wurde eine Melkanlage angeschafft. Die Milch in Kannen wurde von dem Fuhrunternehmer Finnern aus Tankenrade von dem am Wege stehenden Milchbock zur Hansa – Meierei nach Lübeck gebracht.
Die Fruchtfolge auf dem Acker bestand aus:
Winterweizen
Wintergerste mit anschließender Stallmistgabe
Rüben
Winterweizen
Hafer, manchmal auch Mengkorn, mit Kleegras Einsaat
Klee – Gras (Rotklee) zur Heugewinnung
Jeder Siedler hatte die Verpflichtung, einen ha Zuckerrüben anzubauen, diese wurden zur Zuckerfabrik nach Schleswig geliefert. Der Kartoffelanbau wurde bald aufgegeben, weil die Ernte auf dem lehmigen Boden oft recht schwierig war. Das Getreide wurde mit dem Selbstbinder gemäht, in Hocken aufgestellt und dann im Diemen oder in der Scheune eingelagert. Im Spätherbst oder Winter wurde durch den Lohnunternehmer Schwarz aus Ahrensbök gedroschen und das Korn auf den Hausboden getragen und zum Schroten eingelagert oder von den Firmen LHG, Kahlke u. Melcher oder der Spar- und Darlehnskasse abgeholt. Eine große Erleichterung war es als die Dreschmaschine mit einem Körnergebläse und einer Sackhebeanlage ausgestattet war.
Der Sickstoffdünger wurde erst noch mit der Hand gestreut und der Stallmist mit der Forke, die Rüben verhackt und verzogen. Einige haben das Rübenhacken auch an Frauen im Dorf vergeben. Das Heu wurde zum Trocknen auf Reuter gesetzt und das Getreide zum Bindermähen angemäht und von Hand in Garben gebunden. Alles wurde mit Pferd und Wagen gefahren und es gab Arbeit ohne Ende.
Mit der Mechanisierung in der 60er- Jahren kamen die Schlepper auf die Höfe und lösten die Arbeitspferde ab. Dadurch wich auch der Hafer vom Acker. Die Arbeitsleistung stieg gewaltig, ging schneller und leichter und der Fremdarbeitskräfte Bedarf sank. Um 1963 kamen die Mähdrescher und erledigten die Getreideernte in einem Arbeitsgang. Es gab bald 6 Mähdrescher im Dorf. Die Viehbestände wurden stark aufgestockt.
Durch den Ausbau der Landstraße Ahrensbök – Lübeck im Jahre 1956/57 entstanden Verzögerungen bei den Vermessungsarbeiten und so konnten die Siedler erst 1969 Eigentümer werden. Man sagte : „Armer Siedler hier auf Erden – im Himmel wirst du Bauer werden“.
Mit der Zeit versuchte man sich mehr auf Milchviehhaltung und Schweinezucht und Mast zu spezialisieren und wenn möglich den Betrieb durch Landzupacht zu erweitern. Die Hofnachfolger waren aber nicht mehr bereit bei steigenden Arbeits – und Kostendruck die Höfe weiter zu bewirtschaften. Sie wanderten in andere Berufe ab und verpachteten oder verkauften ihre Flächen oder Gebäude. Und so wechselten auch einige Besitzer. „Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen!“.
Fast alle Flächen der Siedler werden zur Zeit von Ortsfremden bewirtschaftet.
Trotzdem kann man sagen, – Alle Siedler sind gut zurechtgekommen.
Erich Marowski, den 29.01.2025